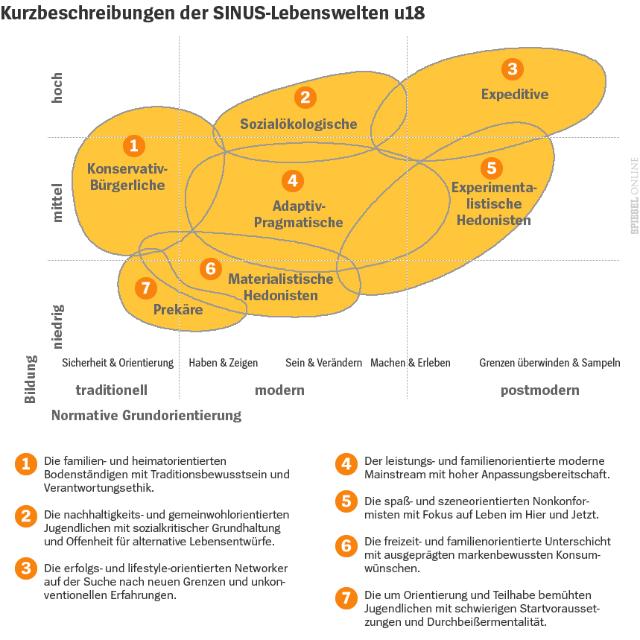Gerade lebt eine Debatte auf, die Soziologen, Anhänger der Opposition und nicht zuletzt ausländische Beobachter elektrisiert: Setzt sich die russische Jugend von der Generation ihrer Eltern ab? Deutet der relativ hohe Anteil von Schülern und Studenten während der Proteste Ende März darauf hin, dass sich die „Generation Putin“ in Russland nun gegen ihren Namensgeber wendet?
Ich habe Russland im vergangenen Herbst verlassen, nach sieben Jahren als Moskau-Korrespondent. Die aktuellen Ereignisse erinnern mich an Diskussionen, die über die Jahre immer wieder in Moskau geführt wurden.
So hatte die angesehene liberale Wirtschaftszeitung Wedomosti 2015 – ein Jahr nach der ihr Protestpotenzial sei höher.
Liberalere Werte als die Eltern? Nein!
Die Gegenrede kam von Anna Schelnina, Jugendforscherin der Moskauer Higher School of Economics. Sie schrieb, ebenfalls in Wedomosti, in Wahrheit handele es sich um eine „verlorene Generation“, verdorben durch konservative Eltern, das autoritäre System und die Propaganda.
Solche pessimistischen Einschätzungen haben bis vor Kurzem klar überwogen. Das Massenblatt „Moskowskij Komsomolez“ fragte etwa angesichts der langjährigen politischen Passivität der 18- bis 24-Jährigen erkennbar konsterniert, „wo denn die Rebellen geblieben“ seien.
„Foreign Affairs“, ein US-Magazin für Außenpolitik, stellte die rhetorische Frage, ob der „Wohlstand der Putin-Epoche – Smartphones, leichter Zugang zum Internet, Reisen ins Ausland – die jungen Leute inspiriert, liberalere Werte anzunehmen als ihre Eltern“. Die Autorin des Textes lieferte die knappe und sehr klare Antwort selbst: „Nein.“ Russlands Jugend wolle „ihr Land als Supermacht wiederhergestellt sehen, die außerhalb der euroatlantischen Gemeinschaft steht und Widerstand gegen internationale Normen leistet“.
Wer hat Recht?
Sind Russlands Junge nun Kinder der neuen Freiheit – oder doch Sprösslinge des Systems Putin? Die Antworten auf diese Frage fallen deshalb so widersprüchlich aus, weil sie beides sind.
Während meiner Zeit in Moskau habe ich Gespräche mit jungen Leuten jedes Mal als besonders interessant empfunden. In den ersten postsowjetischen Generationen verdichtet sich nämlich etwas, das sonst sehr schwer zu fassen ist: der gesellschaftliche Wandel, der Russland seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion erfasst hat.
Im September 2016 habe ich ein Buch darüber veröffentlicht („Generation Putin“). Es beschreibt die Entwicklung einer Reihe junger Russen aus unterschiedlichen Spektren der russischen Gesellschaft, die sich über mehrere Jahre immer wieder Zeit für ausführliche Interviews genommen hatten.
Da ist Lena aus der westrussischen Provinzstadt Smolensk. Sie ist Funktionärin der „Jungen Garde“, verehrt Putin und träumt von einer Politikerkarriere. Die Alexander sitzt im Rollstuhl und träumt vom Auszug aus seinem staatlichen Heim.
In ihren Lebensläufen spiegelt sich die Geschichte Russlands seit 1991: Die Wirren der Neunzigerjahre, die Kriege in Krieg in der Ukraine und vor allem – wie unter einem Brennglas – die Veränderungen in der russischen Gesellschaft insgesamt seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion.
Die 1991 und später Geborenen sind groß geworden im Spannungsfeld zweier Pole: Ihre Generation ist so frei aufgewachsen, wie keine andere in Russland zuvor. Sie leben aber auch in einem Land, das immer autoritärere Züge trägt und seit 17 Jahren von einem Mann geprägt wird: Wladimir Putin.
Wie tickt die Jugend?
Das Verhalten der Jungen mutet gelegentlich paradox an, ihr moderner Lebensstil steht im Widerspruch zu dem reaktionären System, das auch sie unterstützen.
Der Anteil der Putin-Unterstützer ist bei den Jungen ähnlich hoch wie bei den Älteren. Auch die März-Proteste richteten sich zwar gegen Premierminister Dmitrij Medwedew, also einen hohen Repräsentanten der russischen Führung – aber nicht gegen das herrschende System an sich und seine oberste Steuerungsinstanz, Präsident Putin. Die Proteste stellen deshalb nur bedingt einen Widerspruch zu den hohen Umfragewerten Putins dar. Putin vertrete weiter „im Massenbewusstsein die kollektiven Werte und Symbole der russischen Gesellschaft an sich“, sagt Lew Gudkow vom Lewada-Zentrum.
Viele junge Russen geben in Umfragen an, so konservativ zu sein wie ihre Eltern. Eine große Mehrheit der Jungen lehnt, wie die Elterngeneration, eine Gleichbehandlung homosexueller Beziehungen ab, um nur ein Beispiel konservativer Wertvorstellungen zu nennen. Die Moskauer Politologin Jekaterina Schulman konstatiert das „Fehlen eines Generationenkonflikts“. Die Beziehung von Eltern und Kindern ist „warmherzig und vertrauensvoll“. Von einer Jugendrevolte könne keine Rede sein.
Und doch zeigen sich in den Wertvorstellungen junger Russen bemerkenswerte Facetten. Junge Russen denken beispielsweise differenzierter über Michail Gorbatschow. Seit zwei Jahrzehnten verkörpert er für eine überwältigende Mehrheit der Russen etwas Böses.
Kaum ein Jahr, in dem nicht Abgeordnete der Staatsduma fordern, Gorbatschow vor Gericht zu stellen, wegen „Landesverrats“ oder anderer Vergehen. Junge Russen dagegen blicken milder auf ihn.
Einen „Verräter“ sehen in ihm nur 11 Prozent. Und während 71 Prozent der Altersgruppe 45+ überzeugt sind, Gorbatschow habe Russland auf den falschen Pfad geführt, sind es bei den unter 24-Jährigen nur 47 Prozent.
Die „Generation Putin“ ist in bescheidenem Wohlstand aufgewachsen, auch das hat Spuren hinterlassen. Ihre Eltern nennen als mit Abstand wichtigsten Wert „Sicherheit und Stabilität“. Sie haben die schwierigen und instabileren Neunzigerjahre nicht vergessen. Die Berichte über Not und Umwälzungen kennen sie aus den Berichten ihrer Eltern. Selbst bewusst erlebt haben sie diese für das Verständnis des heutigen Russlands so entscheidende Epoche aber nicht.
Bei den Jungen rangiert in Umfragen die „Sicherheit“ auf den hinteren Plätzen, weit vorn steht bei ihnen die „Freiheit“. Die Freiheit, die sie meinen, ist allerdings vor allem das Privileg, Leben und Alltag weitestgehend nach eigenen Vorstellungen gestalten zu können.
Was bedeutet das für das Verhältnis zum Westen?
Laut Umfragen des Moskauer WZIOM-Instituts glaubt die große Mehrheit der „Generation Putin“ – obwohl sie Russland außenpolitisch im Recht sieht – nicht an die These von einem neuen Kalten Krieg. Die Jungen sind überzeugt, dass die derzeitigen Probleme vor allem konkret mit der Krim und der Ukraine zusammenhängen – und eines Tages überwunden werden können.
Russlands Abkehr vom Westen ist erkennbar nicht ihre Wahl. Ein junger hochrangiger Funktionär des Kreml-Lagers hat das einmal so formuliert: „In China will ich auch nicht leben.“
Der Begründer der modernen russischen Soziologie Juri Lewada hatte 1991 wie so viele Intellektuelle auf einen neuen, freieren Menschen gehofft. Später sagte er: „Wer erwartet hat, der Mensch werde ein anderer in drei, zehn, 15 Jahren, rauft sich die Haare. Wandel vollzieht sich nicht in Jahren, sondern in Generationen. Der Kummer rührt von der Größe der Erwartung.“
Gesellschaftlicher Wandel vollzieht sich schleppend und widerstrebend. Für Zeitgenossen geschehen diese Veränderungen frustrierend langsam. Das bedeutet aber nicht, dass es keine gibt. Fast ein Drittel der Russen ist heute jünger als 25 Jahre; mehr als 40 Millionen wurden nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion geboren.
Ihr politisches Profil ist amorph, ihre Vorstellung von der Zukunft verschwommen. Ohne Zweifel aber sind ihre Träume und Bedürfnisse andere als die ihrer Eltern. Diese Bevölkerungsgruppe stellt bis heute eine Minderheit in Russland dar. Sie wird gleichwohl zahlreicher mit jedem Jahr.
Sie können mehr von den Nachrichten auf lesen quelle